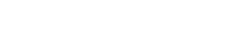Ausgabe 5/2018 Christlichen Medienmagazins pro
Gott ist für den Musiker Martin Pepper mehr ist als ein Wort. Ein Gespräch darüber, wie er diesen Gedanken in seiner Musik verarbeitet und wie man menschlicher Erfahrung Raum geben und trotzdem wirklich Gott anbeten kann.
Martin Pepper, Jahrgang 1958, ist ein christlicher Liedermacher, Theologe, Pastor und Autor. Mit Lobpreistiteln wie „Rückenwind“ oder „Flügelleicht“ wurde er deutschlandweit bekannt. Seine theologischen Ideen verabeitet er in seinen Texten, so auch auf seinem aktuellen Album „Viel mehr als nur ein Wort“.
pro: Ihr aktuelles Album heißt „viel mehr als nur ein Wort“. Steckt dahinter ein Thema, das Ihnen schon länger wichtig ist?
Martin Pepper: Es ist mir schon länger wichtig, allzu einfache Schablonen und Klischees des christlichen Glaubens in ihrer größeren Komplexität zu verstehen. Mit „viel mehr als nur ein Wort“ beziehe ich mich auf das Wort „Gott“. Wenn wir von Gott reden, müssen wir natürlich irgendein Wort verwenden. Außerdem ist Gott ja „das Wort,“ wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt. Der Begriff spielt also eine große Rolle in unserem Verständnis von Gott. Aber all unser Reden von Gott kann schnell zu einer Theorie oder gar einer Ideologie werden. Entscheidend ist am Ende, welche Inhalte und Erfahrungen wir damit verbinden. Ich mache mir Gedanken darüber, in welchen Bildern ich meine Gotteserfahrung auch anderen Menschen verständlich machen kann.
Wie denken Sie denn dann über Gott nach?
Ich glaube, dass man Gott in sich selbst beschreiben könnte als einen Hunger nach Sinn und Bedeutung, einen Ruf zur inneren Einsicht und Versöhnung, eine Liebe, die uns nie aufgibt. Für mich wurde Gott zu einem Ruf zur Umkehr, einem Ruf in die Nachfolge Jesu und in die Gemeinschaft der Christen. Es war ein für mich deutlich vernehmbarer Ruf, der sagte: „Dich meine ich.“
Wenn Sie von Gott als einem Ruf in uns sprechen, heißt das doch, dass wir von Gott nur von uns selbst aus reden können. Wie kann da in Ihren Liedern noch ein Spagat gelingen, diesem menschlichen Fühlen Raum zu geben und trotzdem wirklich Gott anzubeten und nicht doch den Menschen?
Die subjektive Seite darf natürlich nie das Alleinige sein. Wir sind nicht nur auf uns gestellt, sondern haben eine christliche Tradition. Wir haben Texte, die etwas Geschichtliches bezeugen und uns herausfordern. Und wir haben Menschen, zum Beispiel in Gemeinden und Instrumente der Theologie, die uns helfen, sie zu deuten. Es ist eine Frage des Vertrauens, wem wir erlauben, uns zu helfen. So mischen sich subjektive Elemente des Erlebens mit objektiven Elementen wie BibelTheologie und christlicher Gemeinschaft. Doch so objektiv und eindeutig ist die christliche Gemeinschaft auch nicht. Es gibt heute nicht nur die eine Gestalt des Christlichen, sondern viele „Christentümer“. Damit unsere Wahl kein reines „Wunschkonzert“ wird, sollten wir vielleicht im Blick behalten, dass das Heilige uns immer „zweischneidig berührt“. Gott ist (nach Rudolf Otto) nicht nur das „mysterium fascinans“ – das Geheimnis, das uns anzieht –, sondern er ist auch das „mysterium tremendum“ – das Geheimnis, das uns erschüttert.
Wie bilden Sie das in Ihrem kreativen Prozess ab?
Für mich ist diese Komplexität Gottes nur mit Worten zu vermitteln. Der Glaube kommt aus dem Wort der Predigt, sagt Paulus. „Christliche Musik“ ist Bekenntnismusik zum christlichen Glauben. Ich kann keine christliche Musik ohne Worte machen. Sie wird erst dann auch für andere nachvollziehbar zu etwas Christlichem, wenn sie mit einem christlichen Symbol verbunden ist. Nur so kann ich meinen Zeitgenossen mein Verständnis von Gott praktisch näher bringen. Ich bin mir aber bewusst, dass Gott auch in der Musik an sich wirksam ist. Musik ist eines der ganz großen Mysterien unseres Menschseins. Wir verstehen bis heute nicht, warum sie so auf uns wirkt. Musik berührt mich. Manchmal kriege ich eine Gänsehaut, manchmal fließen mir die Tränen. Dieses Angerührtwerden ist von Worten unabhängig; auch dies kann ich für mich nur als ein Wirken Gottes bezeichnen.
Da klingen einige Elemente aus der Mystik an. Auf dem Album kommt das auch vor, zum Beispiel in dem Song „eins mit dir sein“. Woher kommt diese Leidenschaft für das Mystische?
Der katholische Theologe Karl Rahner hat den schönen Satz gesagt: „Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein.“ Will heißen: Man kann als Christ in der Zukunft nur dann existieren, wenn der Glaube mehr ist als ein reines Bekenntnis, als eine Lehre, der man folgt. Er muss etwas sein, das wir fühlen, das mit unserem Innersten in lebendiger Resonanz steht. Diese Resonanz ist es, die mich begeistert. Sie ist bei den Mystikern über die Jahrhunderte immer wieder aufgebrochen, unter anderem als Sehnsucht. Diese Sehnsucht gibt es auch sehr stark in der charismatisch-pfingstlichen Welt, in der ich einen großen Teil meines geistlichen Lebens verbracht habe. Mystik im Sinne von innerer, lebendiger Gotteserfahrung hat mich in meinem Christsein von Anfang an begeistert.
Viele Christen, vor allem Evangelikale, sehen die Mystik kritisch. Sie befürchten, dass dabei die Souveränität Gottes verloren geht, dass man doch nur „hintenrum“ und „esoterisch“ sich selbst anbetet. Was sagen Sie dazu?
Es gibt Mystik sicherlich auch als religiöses Leistungssystem oder eine nebulöse religiöse Selbsterfahrungswelt, die uns den Weg zu Gott, zu dem Jesus ruft, vielleicht sogar verstellt. Wenn ich aber betend sage „Gott, lass mich eins mit dir sein“, dann ist es ein kolossales Missverständnis zu denken, dass ich von mir aus versuche, mit Gott eine Einheit herzustellen. Das wäre menschliche Anmaßung. Wir leben in allem, was wir mit Gott erleben, immer nur von dem, was uns gegeben, geschenkt und offenbart wird. Das ist eine Mystik der Gnade.
„Das Leben, wie Gott es geschaffen hat, hat eine gewisse Selbstständigkeit“
Auch Ermutigendes findet auf Ihrem neuen Album Platz: „Hier wird gegeben und genommen, doch das wird nie mein Vertrauen zerstören“, heißt es zum Beispiel im Song „Das Leben gibt und nimmt“. Wo mussten Sie in Ihrer Musikerkarriere schon Rückschläge einstecken?
Um das Jahr 2003 habe ich eine CD mit Elementen stark elektronischer Musik gemacht, weil ich eine neue Gruppe von Menschen damit für den Glauben an Jesus gewinnen wollte – das war damals in der christlichen Szene noch überhaupt nicht im Trend. Ich bin damit auf Tour gegangen; aber irgendwie ist es mir und den Veranstaltern nicht gelungen, dieses „ Extra Angebot“ von meinem bisherigen Image zu lösen. So kamen die ganzen Fans von „Rückenwind“ und „Vater, wir loben und preisen dich“ samt Kindern in meine verrückten, neuen Produktionen und warteten auf ihre Lieblingslieder. Es gab ein Konzert, da war nach der Pause noch ein Zehntel der Leute da. Dann hab ich das Experiment so schnell wie möglich beendet.
War das Gottes Wirken?
Das Leben, wie Gott es geschaffen hat, hat eine gewisse Selbstständigkeit. Es entwickelt sich in einer Mischung aus Zufall, Notwendigkeit und menschlicher Einflussnahme. Das zu akzeptieren, macht Gott nicht kleiner. Natürlich ist Gott anwesend und wirksam in seiner Welt, aber er bestimmt sie nicht in jedem Detail. Ich gehe heute nicht mehr davon aus, dass Gott einen detaillierten Lebensplan für mich (und alle anderen) vorliegen hat, den ich unbedingt realisieren muss. Ich versuche, aus allem etwas zu lernen. Ich lasse mich von Widerständen und Fehlversuchen nicht unterkriegen, sondern vertraue Gott von ganzem Herzen.
Der abschließende Song auf dem Album ist ein Remix Ihres bekannten Songs „Rückenwind“. Wie gibt Ihnen Gott Rückenwind im kreativen Prozess?
Den größten Rückenwind erlebe ich persönlich beim Lesen. Ich bin ein Mensch, der stark von Gedankenimpulsen beflügelt wird, sei es aus der Bibel oder auch aus nicht religiöser Literatur. Es begeistert mich, weil es mir hilft, meine Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ich mache die Erfahrung, dass meine Gotteserfahrungen durch das, was ich lese und verarbeite, nicht schwächer werden, sondern neu anfangen zu leuchten und widerzuhallen.
Danke für das Gespräch!
Dieses Interview erschien in der Ausgabe 5/2018 des Christlichen Medienmagazins pro.
Die Fragen stellte Martin Jockel.